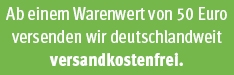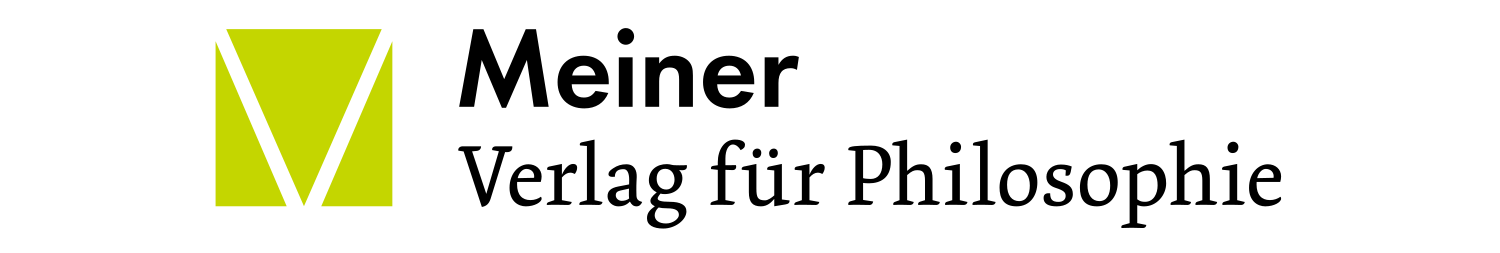Die Frage, ob es Musik gibt, mag zunächst auf Unverständnis stoßen. Offensichtlich scheint es überall auf der Welt Praktiken zu geben, die wir unzweifelhaft als musikalische identifizieren können. Aber ist der Begriff der Musik so einfach zu universalisieren? Kann er transformiert werden, um der Vielfalt dieser Praktiken gerecht zu werden? Wie wäre er dann zu bestimmen? Die Aufsätze des Schwerpunkts gehen diesen Fragen aus unterschiedlichen Perspektiven nach.
Abstracts
Feige, Daniel Martin, Grüny, Christian: Gibt es ›Musik‹? Einführung in ein Problemfeld.
Grüny, Christian: Dezentrierung, Rezentrierung und »Musik«.
Der Begriff der Musik ist problematisch, insofern seine Anwendung auf Praktiken, die nicht von vornherein unter seiner Ägide stattfinden, diese auf eine bestimmte Weise interpretiert und zuschneidet, die ihnen nicht unbedingt gemäß ist. Gleichzeitig verbindet sich mit ihm eine bestimmte Form der Anerkennung, die zu versagen ebenso problematisch wäre; dies verbindet ihn mit dem Begriff der Kunst. Insofern der gegenwärtige Musikbegriff nicht mehr um die westliche Kunstmusik, wohl aber um die rhythmische und melodische Organisation von Klanglichkeit zentriert ist, stellt sich die Frage, ob und wie es möglich ist, ihn zu dezentrieren. Die Forschungen zum evolutionären Ursprung der Musik könnten als Möglichkeit begriffen werden, das Feld der menschlichen Artikulation zwischen Sprache, Gestischem und Musik anders aufzuteilen und zu pluralisieren, wenn sie auf die geläufige Essentialisierung verzichten. Die politische Dimension der (Nicht-)Anerkennung von Praktiken als Musik lässt aber eine solche Pluralisierung schwierig erscheinen.
Janz, Tobias: Was ist ›Musik‹ – und wenn ja, wie viele?. Die Musikwissenschaft auf der Suche nach sich selbst
Aus der Perspektive eines Musikwissenschaftlers versucht der Beitrag nachzuvollziehen, wie das Fach Musikwissenschaft zu seinem wichtigsten Grundbegriff, dem Begriff »Musik« steht. Seit den 1970er Jahren lässt sich in der Historischen Musikwissenschaft, entsprechend dem Strukturwandel der spätmodernen Gesellschaft, eine Verschiebung von einem eher exklusiven zu einem eher inklusiven Musikbegriff beobachten. Es stellt sich dann die Frage, wie den Schwierigkeiten begegnet werden kann, die sich aus universalistischen und kulturrelativistischen Perspektiven gleichermaßen ergeben. Die jüngeren anthropologischen und kulturevolutionären Ansätze der Musikwissenschaft unterschätzen die Schwierigkeiten, die ein maximal geweiteter allgemeiner Musikbegriff aufwirft. Mit Blick auf die praxeologische Wende, die sich in der terminologischen Alternative »Musicking« niederschlägt, wird abschließend deren notwendige Ergänzung durch objektorientierte Perspektiven diskutiert.
Feige, Daniel Martin: Zur Dialektik der postkolonialen Kritik.
Hinsichtlich der Frage, ob es Musik gibt, lässt sich im Geiste von Beiträgen aus dem Umfeld postkolonialer Diskussionen darauf verwiesen, dass der Begriff die Gefahr einer eurozentrischen Verengung aufweise. Der entscheidende Schachzug liegt dabei in dem Gedanken, dass nicht allein das, was unter Musik verstanden worden ist, tendenziell durch Ausgrenzungen gekennzeichnet war, sondern dass der Musikbegriff selbst Ausdruck einer solchen Ausgrenzung ist. Der vorliegende Beitrag unterzieht diese Kritik einer dialektischen Kritik und macht geltend, dass sich die postkoloniale Kritik selbst als als Arbeit am Sinn richtig verstandenen Allgemeinbegriff e verstehen muss, um nicht selbstwidersprüchlich zu werden. Ihre Gegen-Geschichten, so lautet die weitergehende Konsequenz dieses Gedankens, müssen weiterhin vom Erbe der Aufklärung her verstanden, allerdings als Teil einer richtig verstandenen Dialektik der Aufklärung. Es gilt damit weniger, den Musikbegriff zu verabschieden, als seinen interne Bruchpunkten nachzugehen.
Mahrenholz, Simone: Musik und Begriff. How to do things with music.
Der Text präsentiert drei miteinander verbundene Thesen. (1) Philosophie der Musik modifi ziert philosophische Grundbegriffe. (2) Eine gemeinsame Eigenschaft in der Vielfalt der Musikformen liegt im Effekt einer Wahrnehmungsveränderung: oft subtil, unterschwellig und zuweilen als ekstatisch erlebte Selbst- und Welt-Transformation. (3) Strenggenommen nehmen wir nicht Töne wahr, sondern a) unsere Hör-Physiologie wandelt Schwingungsfrequenzen ab circa 18 Hz in Tonhöhen um und damit Zeit-Organisation in ein Raum-Äquivalent. (Musik mit tiefen Tönen an der Grenze zur Wahrnehmung, etwa mittels großer Orgelpfeifen in Kathedralen oder Ton-Anlagen in Nachtclubs, inszeniert genau diesen physiologischen Umschlag, mit potentiellen Transzendenz-Effekten.) b) Wir nehmen einfache Frequenzverhältnisse wie 1:2, 2:3 etc. als (relativ) konsonant wahr, komplexere Verhältnisse als (relativ) dissonant. Die Folge: c) Musikhören verbindet uns mit physikalischem Verhalten von Materie, einschließlich unserer selbst. Hierin gründen rare, musikalisch herausgehobene Eindrücke von Erkenntnis und Enthüllung: das Universum betreffend und unsere Stellung in ihm.
Breuer, Irene: Die sinnlich-affektive Verflechtung von Welt, Raum und Leib in Husserl und Merleau-Ponty. Die Atmosphäre als intensive Gefühlskraft und ihr architektonischer Ausdruck
Der Beitrag widmet sich der Entwicklung der Untersuchungen Husserls und Merleau-Pontys in Bezug auf die Wechselverhältnisse zwischen Welt, Raum und Leib. Die These besagt, dass die ›genetische‹ Einsicht, die leiblich aff ektive Erfahrung verleihe der Welt einen subjekt-relativen Sinn, anfänglich zu einer Umkehrung des Fundierungsverhältnisses und schließlich zur Ausarbeitung der Urhyle als sinnliches Prinzip bei Husserl geführt hat, während sie Merleau-Ponty dazu verleitet hat, die Unterscheidung ›Bewusstsein-Objekt‹ zu revidieren und eine Ontologie des Fleisches zu entwickeln. Aus dieser Initialthese wird sich zeigen, dass die durch pathische Empfindungen, Gefühle und Stimmungen hervorgebrachte Verschränkung von Leib und Ort die existenzielle Dimension der Raumerfahrung, das ›Hier-in-einem-Ort-zu-sein‹, ausmacht. Der Begriff der Atmosphäre verbindet diese Einsichten mit der Architekturerfahrung: Insofern eine Atmosphäre alle unsere Sinne durch optische und haptische Empfindungen simultan ergreift, gleicht sie einer intensiven Gefühlskraft und stellt die Dauer und die affektive Dimension eines Seins-in-Situation hervor. Sie veranschaulicht somit das Erklärungspotential der genetischen Phänomenologie für die Architektur.
Rehm, Robin: »Bildarchitektur«. Paul Klees Vorführung des Wunders 1916/54 und Walter Benjamin.
Der Aufsatz wendet sich Walter Benjamins Aquarell Vorführung des Wunders von Paul Klee zu, also jenem Werk, das bereits 1920 – ein Jahr vor der aquarellierten Ölfarbezeichnung des Angelus novus – in seine Sammlung gelangt. Wesentliches Element des Bildes sind die Liniengefügen, von denen sich die Figuren und der Schauplatz mitsamt schmaler Bühne absetzen. In der damaligen Kunstkritik und Ästhetik werden solche Konstruktionen aus Linien im Sinn eines Architektonischen verstanden, das heißt als ein das Bild konstituierendes Regime. Benjamin beschäftigt sich mit entsprechenden Liniengebilden als Grundproblem der Malerei des Kubismus schon 1917 in Briefen an Gershom Scholem. Die dabei entstandenen Reflexionen bereiten gewissermaßen Benjamins Begegnung mit Klees Vorführung des Wunders und den sich dort zeigenden Liniengebilden vor. Die These lautet, dass Benjamin eine analoge, mittels Linie hergestellte Bildkonstruktion als Architektur begreift. Der Beitrag analysiert Benjamins Überlegungen zum Architektonischen im Verhältnis zur zeitgenössischen Kunstkritik und Ästhetik.
Müller-Salo, Johannes: Zur Struktur alltagsästhetischer Erfahrung.
Ausgehend von einer Bestimmung der ästhetischen Erfahrung als Erfahrung der Art und Weise der sinnlichen Gegebenheit von Gegenständen und Umwelten geht der vorliegende Text der Frage nach den Spezifika alltagsästhetischen Erfahrens nach. Dabei wird zunächst die alltagsästhetische Einstellung als eine fest in den handelnden Vollzug gewohnter Praktiken und Routinen eingebettete Wahrnehmungshaltung bestimmt. In einem nächsten Schritt werden charakteristische Merkmale alltagsästhetischen Erfahrens herausgearbeitet: Zu nennen sind die Wahrnehmung von – theoretisch näher zu beschreibenden – Ganzheiten, die Kategorien des Vertrauten, des Rhythmus und des Takts sowie schließlich das Zusammenspiel aller Sinne. Die abschließenden Überlegungen widmen sich der engen Verbindung von moralischen, ästhetischen und funktionalen Erfahrungen und Urteilen im Raum des Alltäglichen.
Saratxaga Arregi, Arantzazu: Allometrische Kunst. Weiblich demarkierte Artefakte in der Altsteinzeit. Eine Unterscheidung von einer Unterscheidung.
Der Beitrag handelt von einer Auslegung der Bedeutung anthropomorphischer Figurinen der Altsteinzeit, insbesondere auf der Basis der beispielhaften Plastik Venus von Willendorf. Der Kern des Artikels liegt in der kritischen Frage der Repräsentationsordnung von hervortretenden Merkmalen kleiner Plastiken und versucht den hermeneutischen Rahmen der Morphologie der Figurinen zu erweitern. Was erzählen uns diese Formen? Inwiefern stehen die weiblichen Demarkationen für eine Darstellung der Weiblichkeit? Um diese Fragen zu beantworten, wird zunächst der ästhetische Wert der Artefakte problematisiert, da sich ihre künstlerische Beschaffenheit an ihrer Form, frei von jeder instrumentalen Bestimmung, zeigt. Dem folgt eine kritische Analyse der metaphysischen Darstellung von Form, zurückgehend auf Platon, dem zufolge die Form eine Idee (eídos) darstellt. Dieses Schema führt allerdings zu einem tautologischen Teufelskreis, bei dem jede weibliche Figuration eine Idee der Weiblichkeit darstellt, die aber weit weg von einem idealen Urbild und mehr ein kultureller Ausdruck ist. Dementsprechend gehe ich vom semiotischen Turn aus, laut dem ein Zeichensystem an der Stelle von Darstellungen steht, um die Frage der symbolischen Bedeutung weiblich demarkierter Merkmale zu behandeln. Die Markierungen sollen für einen Unterschied stehen. Dieser Unterscheid ist, im Anschluss an Spencer Browns Formtheorie und Niklas Luhmanns Rezeption davon, eine Unterscheidung einer Markierung eines unmarked space. Zum Schluss wird die symbolische Ordnung weiblich demarkierter Artefakte präsentiert, wobei sie ein Gefüge einer markierten eidetischen Differenz (Art-Differenz) eines Mutter-Menschen ist, die wiederum für einen unmarked space, nämlich die Markierung eines Verlusts, steht.
Viglialoro, Luca: Zum Sinn. Nachruf auf Jean-Luc Nancy (1940–2021).