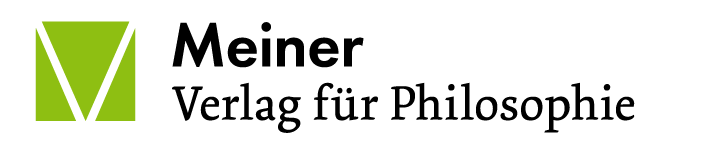Zeitschrift für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft 66/1

Herausgegeben von Josef Früchtl und Philipp Theisohn
Wird geladen …
Ab:
94,00 €
Ab:
ca.
Beschreibung
Bibliographische Angaben
| Einband | |
|---|---|
| DOI | |
| Auflage | |
| ISBN | |
| Sprache | |
| Originaltitel | |
| Umfang | 166 Seiten |
| Erscheinungsjahr (Copyright) | 2021 |
| Reihe | Zeitschrift für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft |
| Herausgeber/in | Josef Früchtl Philipp Theisohn |
| Beiträge von | Claudia Benthien Julia Catherine Berger Carsten Dutt Sarah Hegenbart Burkhard Liebsch Angela Rapp Carolin Rocks Kim Sher Michael Wedel |
| Hersteller nach GPSR |
Felix Meiner Verlag GmbH |
Service
Einzelartikel als PDF
Allusion und Reflexion in Jeff Walls Fotoarbeit The Flooded Grave
Wie viele der monumentalen Fotoarbeiten Jeff Walls ist The Flooded Grave (1998- 2000) ein Werk, dem das Medium Fotografie selbst zum Thema wird – auf gedan- kenweckend paradoxe, Gesten dokumentarischer Kontingenz und Markierungen fiktionalen Arrangements amalgamierende Weise. Analysen, die vorrangig oder exklusiv auf diesen Befund abstellen, können die Komplexität und Individualität der Bilderfindung Walls freilich nicht angemessen erfassen. Hierfür bedarf es viel- mehr der Einsicht in allusiv fundierte Reflexionsstrukturen, die The Flooded Grave auf ikonografischer und bildtypologischer Ebene zu historisch indizierten Formen christlicher Kunst in Beziehung setzen. Der vorliegende Beitrag unternimmt den Versuch, sie zu identifizieren, ihre werk-interne Synergie zu beschreiben und im Wege »denkender Betrachtung« (Hegel) über ihre ästhetische, künstlerische und spirituelle Bedeutung Auskunft zu geben.
16,90 €
Aktuelle Perspektiven eines barocken Motivs und ihre Gestaltung von Zeitlichkeit
Das Aufgreifen tradierter Motive, speziell des frühneuzeitlichen Vanitas-Topos, lässt sich in zeitgenössischer Literatur, Theater und bildender Kunst beobachten. Insbesondere die Videokunst weist dabei eine Affinität zum malerischen Genre des Stilllebens auf, welches im Kontext des Topos mit moralisch-religiösen und philo- sophischen Fragen verbunden ist und eine Integration unterschiedlicher Zeitmodi ermöglicht. In Anlehnung sowohl an frühneuzeitliche Zeitkonzepte als auch an aktuelle Theorieansätze werden Gestaltungsformen von Zeitlichkeit untersucht, die durch Film- und Videotechnik entstehen, dabei die innerbildlichen Tempora- litäten statischer Stillleben erweitern und die Symbolik der Vanitas resemantisieren, verfremden oder negieren. Es wird nicht nur gezeigt, wie diese Symbole in der Gegenwartskunst eingesetzt werden, um über Vergänglichkeit und Tod zu reflek- tieren, sondern insbesondere, welche Möglichkeiten neue Technologien aufweisen, das Vergehen von Zeit ästhetisch zu gestalten. Der Beitrag präsentiert eine erste Systematisierung von Vanitas-Stillleben in der Videokunst und gibt einen Einblick in facettenreiche Auseinandersetzungen mit einem klassischen Genre.
16,90 €
Praxeologie, Foucaults ethische Praktiken und die Literaturwissenschaften
Der Aufsatz sondiert das geisteswissenschaftliche Feld einer Theorie von Praktiken mit dem Fluchtpunkt der Literaturwissenschaften. In der germanistischen Forschung hat der Fokus auf Praktiken zur Neujustierung der Literatursoziologie geführt, der eine dezidierte praxeologische Begründung fehlt. Die ›Ursprünge‹ praxeologischer Theoriebildung liegen in der Soziologie, deren aktuelle Positionierungen die Analyse von Praktiken mit poststrukturalistischen Theoremen zu verbinden suchen. Dabei werden Michel Foucaults Diskurskonzept und dessen Arbeiten zu den antiken Praktiken des Selbst in ein kultursoziologisches Programm integriert (Reckwitz). Der Beitrag argumentiert, dass dies Foucaults eigenem Verständnis von Praktiken zuwiderläuft. Denn anders als die sozialtheoretische Praxeologie denkt Foucault Praktiken nicht als ein zwischen agency und structure vermitteln- des Handlungsterrain. Sein doppelter Praktikenbegriff stellt eine unhintergehbare Interdependenz von Prozessen der Disziplinierung und ästhetischer Formung, von Norm und Freiheit zentral und bringt so einen genuin ethischen Gehalt von Praktiken ins Spiel. Foucaults Ausführungen zur ästhetischen Form von Praktiken sind aber so wenig spezifisch, dass hier ein Einsatzpunkt für die Literaturwissenschaften liegt, den ›späten‹ Foucault für eine Revision der Dynamiken von Ethik und Ästhetik produktiv zu machen. In dieser Perspektive lassen sich die Künste nicht als Zirkulationsräume ethischen Wissens, sondern als praktische Erprobungsfelder moralischer Formungsprozesse verstehen, in denen sich Normerfüllung und agency verbinden. Anvisiert wird dergestalt ein Beitrag zur Theorie des Zusammenhangs von Ethik und Ästhetik, der es ermöglicht, die ästhetische Formung praktischer Moralität und in diesem Sinne das ethos, ja die konkreten Tugendübungen der Literatur zu untersuchen.
16,90 €
Der Begriff des »Zombie Formalismus« beschreibt eine Form der Kunst, welche die Intention verfolgt, die Bedürfnisse des Marktes zu erfüllen. Gegenwärtige Entwicklungen des Kunstmarkts fordern die institutionelle Theorie von Kunst heraus, da es zunehmend fraglich erscheint, dass ›die Kunstwelt‹ – das Kernstück der institutionellen Theorie – noch von einem tiefgehenden Kunstverständnis anstatt von ökonomischen Interessen geleitet wird. Da die institutionelle Theorie ›die Kunstwelt‹ an sich sehr vage definiert, könnte diese auch wirtschaftlich orientierte Sammlerinnen und Galeristen einschließen. Wenn der monetäre Wert von Kunst aber die treibende Kraft für die Erschaffung von Kunst ist, stellt sich die Frage, wie dies die Kunstwelt als Institution, die darüber entscheidet, ob etwas als Kunst gelten kann, beeinflusst. Um diese Frage zu beantworten, werde ich mich mit neuesten Entwicklungen der zeitgenössischen Kunstwelt auseinandersetzen, da diese es erfordern, die institutionelle Theorie so zu modifizieren, dass sie auf gegenwärtige Phänomene anwendbar ist. Als Ausblick werde ich vorschlagen, dass David Humes allgemeiner Maßstab für das Geschmacksurteil zur Entwicklung eines Maßstabs für das kuratorische Urteil beitragen könnte. Möglicherweise könnte dieser kuratorische Maßstab dazu dienen, dass Kuratorinnen als unabhängige Gatekeeper fungieren.
16,90 €
Zur Beschreibung der Diskussionslage – in pathisch-ästhetischer Perspektive
Aktuelle Forschung fasst vielfältige Gewaltphänomene als politische Herausforderungen auf, die vor allem durch Hobbes’ philosophische Schriften zur Sprache gekommen sind. Seitdem erwartet man, dass eine politisch-rechtliche Ordnung diese Gewaltphänomene in Schach halten bzw. aufheben soll. Dagegen hat die aktuelle Diskussion um den Zusammenhang von Gewalt und Ordnung Quellen einer außer-ordentlichen Widersetzlichkeit gegen Gewalt zum Vorschein gebracht. Dieser Essay lenkt mit Bezug auf Levinas und Waldenfels die Aufmerksamkeit auf die Folgen, die sich daraus für die Philosophie der Gewalt ergeben.
16,90 €
The video-footage from the Museum of Mosul as an ›end‹ of the theory
In seinen Vorlesungen über die Ästhetik aus den 1820er Jahren stellt Hegel die berühmte These auf, dass Kunst als eine Form des Absoluten ihr finales und fortgeschrittenstes Stadium in der Selbstauflösung der Romantik erreicht habe. Anschließend an Hegel schlägt der Kunstkritiker und Philosoph Arthur C. Danto am Ende des 20. Jahrhunderts in einer Reihe von Aufsätzen vor, dass die Konzeptkunst seiner Zeit mit der These vom Ende der Kunst übereinstimmt. Kunst ist demnach abhängig von Theorie und nicht mehr von historischer Relevanz. Um über die Bedeutung von Hegels These für uns heute nachzudenken, benutzt der vorliegende Essay das notorische Video, das der sogenannte Islamische Staat (ISIS) 2015 produziert hat. Es zeigt, wie diese militante Gruppe gewaltsam jahrhundertealte Skulpturen im Museum von Mosul zerstört. Obwohl weder die im Video gezeigten Skulpturen noch das Video selbst von uns als Kunstwerke angesehen werden, wurden diese Werke in der Vergangenheit als Kunst entworfen, und paradoxerweise überleben sie nur als Videoaufnahme ihre materielle Zerstörung, sodass sie für uns als Erscheinung gegenwärtig bleiben. Einerseits bestätigt der Inhalt des Videos Hegels Behauptung, dass die Kunst »für uns ein Vergangenes ist«; andererseits verweist es auf eine neue Form des Ausdrucks jenseits der These vom Ende der Kunst.
6,90 €
Eine verpasste Begegnung mit der »Gesellschaft für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft«
Ausgehend von der geplanten, letztlich nicht zustande gekommenen Teilnahme des Filmregisseurs Friedrich Wilhelm Murnau am zweiten Kongress der Gesellschaft für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft verfolgt der Beitrag zwei Absichten: Zum einen skizziert er die Anfänge der Auseinandersetzung der Gesellschaft und ihrer Zeitschrift mit der Frage nach der Kunstfähigkeit des Films. Zum anderen nimmt er die geplante Mitwirkung Murnaus zum Anlass, dessen ästhetische Ansichten in einen Dialog mit Positionen zu versetzen, wie sie in dieser Frage auf dem 1924 nachgeholten Kongress und in der Zeitschrift der Gesellschaft vertreten wurden. Die Übereinstimmungen, die sich zwischen den Auffassungen feststellen lassen, zeugen von der Ernsthaftigkeit, mit der die Gesellschaft, wenn auch nur für kurze Zeit, die Modernisierung ihrer Kunstreflexion und deren Öffnung auf die ästhetische Praxis und die technischen Medien hin betrieben hat. Mit Blick auf Murnau dokumentieren sie die wache Zeitgenossenschaft eines Regisseurs, der noch immer zu Unrecht als »Romantiker« und »Melancholiker« des Films gilt.
6,90 €
Für die aktuelle Museumsliteratur sind selbst ›einfache‹ Museumsdinge (um die es in diesem Beitrag nur gehen wird) wie Knochen oder Pfeile so etwas wie ›Als-ob- Kunstwerke‹: ästhetisch etwa als schön oder hässlich anzusehen, aber von unklarer Bedeutung. Dieser Beitrag zeigt, warum Exponate keine Dinge von diffuser Bedeutung, sondern (vorgefundene) Zeugnisse sind, die Aussagen über Sachverhalte (meist der Vergangenheit) belegen und anschaulich machen. Dinge im Museum sollen aber immer auch ästhetisch erlebt werden. Das macht sie besonders und zu Vexierfiguren, die uns verblüffen. Exponate erkennend als Zeugnis oder ästhetisch zu betrachten, richtet sich nach klar und eindeutig zu trennenden Kriterien. Beides hat nichts miteinander zu tun. Dennoch ist es nur unsere Aufmerksamkeit, die sich auf bestimmte Aspekte eines Objekts richtet, ohne dass die anderen verschwinden. So bleibt die eine Art zu sehen in der anderen im Hintergrund präsent und kann unsere Wahrnehmung beeinflussen.
16,90 €