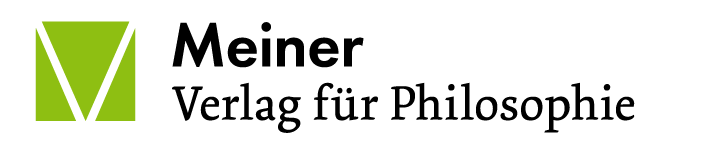Zeitschrift für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft, Band 65. Heft 1: WERK-ZEUGE
Der Werkbegriff zwischen den geisteswissenschaftlichen Disziplinen

Herausgegeben von Josef Früchtl und Philipp Theisohn
Downloadartikel sofort verfügbar
Wird geladen …
94,00 €
ca.
Beschreibung
Bibliographische Angaben
| Einband | |
|---|---|
| DOI | 10.28937/ZAEK-65-1 |
| Auflage | Unverändertes eJournal der 1. Auflage von 2020 |
| ISBN | |
| Sprache | |
| Originaltitel | |
| Umfang | |
| Erscheinungsjahr (Copyright) | 2020 |
| Reihe | Zeitschrift für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft |
| Herausgeber/in | Josef Früchtl Philipp Theisohn |
| Beiträge von | Amrei Bahr Dieter Burdorf Íngrid Vendrell Ferran Johannes Grave Pfotenhauer Helmut Thomas Kater Reinhold Schmücker Johannes Waßmer |
| Hersteller nach GPSR |
Felix Meiner Verlag GmbH |
Einzelartikel als PDF
Schwerpunkt: Werk-Zeuge. Der Werkbegriff zwischen den geisteswissenschaftlichen Disziplinen
0,00 €
Prolegomena zu einer Taxonomie produzierter Entitäten
Was verbindet all diejenigen Dinge miteinander, auf die wir mit dem Werkbegriff Bezug nehmen? Der vorliegende Beitrag begründet, warum der Artefaktbegriff weiter gefasst werden sollte, als es in der Artefaktphilosophie üblich ist. Folgt man
17,90 €
Annäherungen an einen geisteswissenschaftlichen Grundbegriff
Als zentrale Untersuchungsgegenstände sind Werke in den Geisteswissenschaften omnipräsent. Befragen wir geisteswissenschaftliche Disziplinen danach, was Werke eigentlich auszeichnet, sind wir allerdings mit einer Vielfalt disparater Auffassungen konfrontiert. Der Beitrag plädiert für einen begründet restriktiven Umgang mit dieser Vielfalt geisteswissenschaftlicher Werkkonzepte, um der je individuellen Leistungsfähigkeit der Konzepte angemessen Rechnung zu tragen. Funktionen des Werkbegriffs kommt dabei eine Schlüsselrolle zu: Innerhalb geisteswissenschaftlicher Praktiken erfüllt der Werkbegriff je unterschiedliche Funktionen, deren Explikation in doppelter Hinsicht von Nutzen ist. Zum einen können diese Funktionen als Gründe dafür dienen, bestimmte Praktiken der Verwendung des Werkbegriffs gegenüber anderen zu privilegieren. Zum anderen befördert es den (inter)disziplinären Austausch, wenn wir uns der Funktionen gewahr werden, die dem Werkbegriff innerhalb unserer Praktiken zukommen.
17,90 €
In diesem Aufsatz wird zunächst der Begriff ›Fragment‹ im Kontext einer Theorie des ›Werks‹, also des abgeschlossenen Artefakts, geklärt. Es wird gezeigt, dass Fragmente im Gegensatz zu Werken in mindestens einer Hinsicht defiziente Artefakte sind. Im folgenden Schritt wird herausgearbeitet, wo das Fragment an seine Grenzen kommt. Gemeint ist dabei einerseits die materielle Abgrenzung des Fragments von seiner Umgebung durch Schnitte, Brüche und Konturen, andererseits die begriffliche Abgrenzung des Fragments von benachbarten literarischen Formen der Prosa und der Lyrik wie Aphorismus, Skizze, Entwurf, Montage und Monostichon. Ferner wird ein Blick auf ›totale Fragmente‹ (George Steiner), also Extremformen der Fragmentierung, geworfen, vor allem auf solche Fälle, in denen Artefakte ganz oder nahezu ganz gescheitert, verloren oder zerstört sind, also ein Maximum an Defizienz aufweisen. Der Schwerpunkt der Überlegungen liegt im Bereich der Literatur; andere Künste und Medien werden jedoch durchgehend vergleichend herangezogen.
17,90 €
Zur Aktualität der phänomenologischen Unterscheidung zwischen Kunstwerk und ästhetischem Objekt
Das Fach Kunstgeschichte hat den Werkbegriff – anders als den Kunstbegriff – kaum zum Gegenstand eigenen Nachdenkens gemacht. Dennoch hat der Begriff die Praxis der Disziplin nicht unwesentlich geprägt. Selbst im aktuellen Fachdiskurs, der das Wort ›Werk‹ aufgrund seiner Konnotationen oftmals durch andere Begriffe ersetzt, wirken einige Implikate der Werkästhetik nach. Dies gilt insbesondere für jüngere Überlegungen zur Macht von Bildern und zur agency von Artefakten. Der Beitrag nimmt diese Ausgangslage zum Anlass, um an die phänomenologische Grundunterscheidung zwischen dem dinglichen Kunstwerk und dem durch den Betrachter mitkonstituierten ästhetischen Objekt zu erinnern. Diese fundamentale Differenzierung, die im Anschluss an Mikel Dufrenne näher erläutert wird, könnte jenseits der Scheinalternative zwischen konstruktivistischen und animistischen Ansätzen einen neuen Weg weisen, um zu verstehen, warum Bildern und Artefakten so häufig Macht oder agency zugesprochen wird.
17,90 €
Der Wille zur Macht zwischen epistemischem Ding und boundary object
Mein Beitrag versteht den Werkbegriff nicht nur als ästhetischen, sondern auch als epistemischen Grundbegriff. Ausgehend von einem nachgelassenen Fragment Friedrich Nietzsches, das Eingang in Der Wille zur Macht – einen Text mit prekärem Werkstatus – gefunden hat, wird in drei Schritten argumentiert: (1) Der Werkbegriff ist an verschiedenen Prozeduren in den Geisteswissenschaften beteiligt und bleibt auch dann erhalten, wenn ein werkästhetischer Werkbegriff abgelehnt wird. (2) Innerhalb dieser Prozeduren kommt dem Werkbegriff eine gemeinsame Funktion zu. Sie besteht in der Konstitution epistemischer Dinge. Die Ähnlichkeit der Prozeduren des Werkbegriffs in den Geisteswissenschaften kann mit dieser Beschreibung auch über methodische und disziplinäre Grenzen hinweg beschrieben werden. (3) Der Wille zur Macht wird auch für kulturelle bzw. kulturökonomische Zwecke in Dienst genommen. Der Werkbegriff ist ein Grenzbegriff über die Wissenschaft hinaus. Er bildet boundary objects.
17,90 €
Praxeologische Perspektiven auf die Kategorie des Werks
Der Beitrag perspektiviert das Verhältnis von Werk und Wissenschaften auf zwei fache Weise: zum einen nimmt er das künstlerische Werk als ›Gegenstand‹ der Wissenschaften in den Blick. Ausgehend von Werkausgaben wird gezeigt, dass und inwiefern die Literaturwissenschaft im Rahmen der Editionspraxis maßgeblich an der Konstitution ihrer primären Forschungsgegenstände beteiligt ist. Zum anderen werden Werke als ›Medien‹ der Wissenschaften untersucht. Dabei wird nach den Implikationen des Werkstatus von Forschungsarbeiten für die wissenschaftliche Praxis gefragt. Neben der Kategorie des wissenschaftlichen Œuvres werden dazu spezifische Werktypen (Standardwerke, Dissertations und Habilitationsschriften) untersucht und auch die medialen Rahmenbedingungen von wissenschaftlichen Werken reflektiert. Aus dieser Doppelperspektive erweist sich die Kategorie des Werks als aufschlussreicher Bezugspunkt für die Untersuchung von disziplinspezifischen und disziplinübergreifenden Wissenschaftspraktiken.
17,90 €
Der Erkenntniswert von Dokumentarfilmen
In diesem Aufsatz argumentiere ich, dass alle Dokumentarfilme darauf abzielen, uns Erkenntnis über einen Aspekt der Realität zu vermitteln. Dieser These zu folge sind Dokumentarfilme – im Unterschied zu anderen Filmgattungen – der Wirklichkeit verpflichtet. Vor diesem Hintergrund sollen in diesem Aufsatz zwei Aspekte genauer untersucht werden: zum einen, wie der kognitive Wert von Dokumentarfilmen genauer zu verstehen ist, und zum anderen, inwiefern ausgehend von diesem epistemischen Aspekt Unterscheidungskriterien zwischen Dokumentarfilmen und anderen Filmgattungen entwickelt werden können. Der Aufsatz gliedert sich in zwei Teile. Im ersten Teil werde ich die Frage untersuchen, inwiefern Dokumentarfilme ›Dokumente‹ der Realität sind. Dabei werde ich verschiedene Interpretationen des epistemischen Ziels von Dokumentarfilmen besprechen und auch die ›Vergegenwärtigungsansicht‹ als Ergänzung zu der ›assertorischen Ansicht‹ (Plantinga, Carroll und Currie) und zu der ›Verstehensansicht‹ (Dromm) anbieten. Im zweiten Teil sollen die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen Dokumentarfilmen und Spielfilmen besprochen werden, um genauere Unterscheidungskriterien zu entwickeln. Ich werde hierfür den phänomenologischen Begriff der Imagination (Sartre, Meunier) einführen und seine Produktivität für die Debatte über den kognitiven Wert von Dokumentarfilmen aufzeigen.
17,90 €
Claudia Keller: Lebendiger Abglanz – Goethes Italien-Projekt als Kulturanalyse. Göttingen: Wallstein Verlag 2018 (Ästhetik um 1800, hg. von Johannes Grave, Sabine Schneider, Bd. 11). 472 S. 27 Abb.
6,90 €